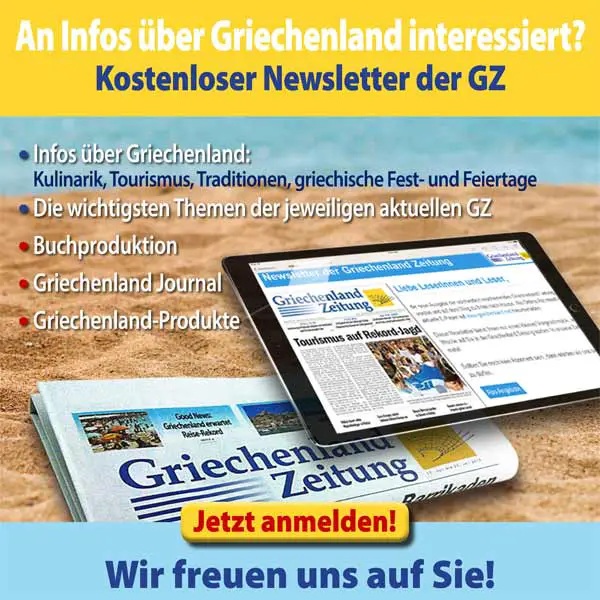Palmsonntag ist die im deutschen Sprachraum um 1700 eingeführte Übersetzung der kirchenlateinischen dominica palmarum oder dominica in palmis für den Sonntag vor Ostern. „An diesem Tage werden in der katholischen Kirche zur Erinnerung an den Einzug Christi in Jerusalem Palmzweige (bzw. andere zu dieser Zeit blühende oder grünende Zweige) geweiht und in einer Prozession mitgeführt“ (Lexikon Pfeifer).
Der Beleg für die Palmzweige ist im Johannesevangelium 12, 13 τὰ βάϊα των φοινίκων – ta vaia ton finikon – die Palmzweige der Palmen. Finix – φοίνιξ, heute finikas, ist die Palme. Wenn nun nicht nur in dem zitierten Lexikonartikel auf die Katholische Kirche verwiesen wird, so muss als erstes dazu bemerkt werden, dass das Neue Testament eine Quelle in griechischer Sprache ist, und der Einzug Christi in Jerusalem in der Griechisch-Orthodoxen Kirche am Palmsonntag, d. h. Κυριακή των Βαΐων – Kiriaki ton Vaion vorrangig und schon immer groß gefeiert wurde und wird. Doch wie das mit den Fremdwörtern so ist, schadet eine zusätzliche Erklärung nicht. Die koptischen Vaja – βάϊα waren der Terminus für die Palmzweige. Der Zusatz im Johannesevangelium Palmzweige der Palmen ist das, was wir eine Tautologie nennen. Nun weiß zwar jeder Christ, dass es sich um Palmzweige handelt, aber woher sollten die denn in allen Ländern nördlich von Israel für den Prozessionsschmuck gefunden werden. Die Lösung sind die im obigen Zitat genannten „anderen zu dieser Zeit blühenden oder grünenden Zweige.“ In Griechenland sind das die „grünenden“ Zweige und Blätter vom Lorbeerbaum. Und davon gibt es ja genug.
Den gesamten Text von Prof. Hans Eideneier zu diesem Thema lesen Sie in der Ausgabe der Griechenland Zeitung (GZ 967), die am 9. April erschien. Bestellungen hier.