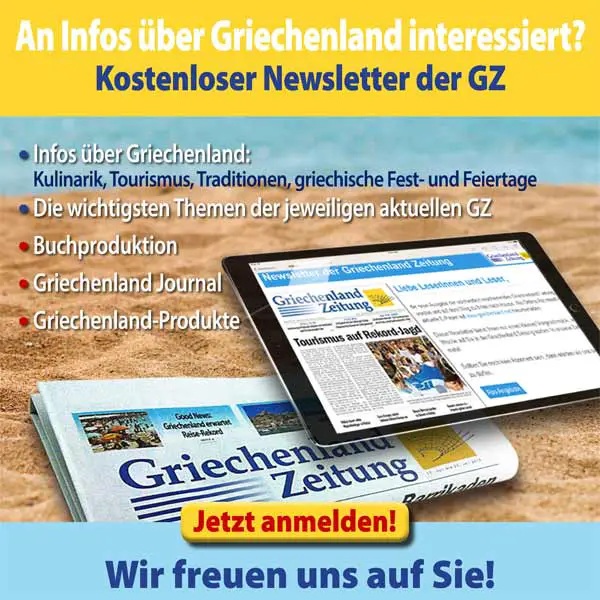Auf einen verregneten Mai folgte der Juni mit plötzlich hereinbrechender, ungewöhnlicher Hitze. Kolokotronis hatte Tripolis von allen Seiten eingeschlossen. Den türkischen Posten, die Tag und Nacht auf den Zinnen der Stadt Wache hielten, schienen die umliegenden Berge förmlich zu glühen von den roten Fezen der Griechen. „Der Griechen!“ Keiner wagte mehr, sie Rebellen zu nennen.
Die Lage in der umschlossenen Stadt verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Mehrmals versuchten die Türken, die Blockade zu durchbrechen. Doch wozu? Selbst wenn der Versuch gelungen wäre, wohin hätten sie sich wenden, was hätten sie unternehmen sollen? Die ganze Peloponnes war bereits in griechischer Hand. Aber jeder Ausbruchsversuch war ohnehin zum Scheitern verurteilt. Die Linien des Kolokotronis standen fest und unerschütterlich. Des Kechaja-Beys Truppen kehrten nach jedem Ausfall geschlagen in die Stadt zurück. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung machte sich breit. Die Lebensmittel fingen an knapp zu werden, und in der Verwaltung gab es keine starke Hand, die für eine gerechte Verteilung hätte sorgen können. Die Arvaniten in türkischem Sold bemächtigten sich rücksichtslos der Vorräte und verkauften sie zu Wucherpreisen. Zusehends traten sie frecher und selbstherrlicher auf und ließen sich von niemandem mehr Vorschriften machen. Die Türken waren nicht imstande, sie zu überwachen, geschweige denn, sie im Zaum zu halten. Nicht nur Hunger quälte die Bevölkerung. Auch Krankheiten verbreiteten sich in der belagerten Stadt. Seit den ersten Tagen des Aufstandes waren Türken aus allen Richtungen nach Tripolis geströmt, sodass die Einwohnerzahl der kleinen Stadt auf das Dreifache gestiegen war. Mit dem Gedränge nahmen Schmutz und Unrat überhand, und ein böses, typhusartiges Fieber brach aus. Kaum ein Haus blieb von Krankheit verschont, und nur ein kleiner Teil der Erkrankten kam mit dem Leben davon. Im Juli, da die Hitze noch größer wurde, führten die Griechen neue Streitkräfte heran. Der Ring um die Stadt wurde enger. Die Kampflust der Türken schien völlig erlahmt. Sie machten keine Ausfälle mehr, sondern beschlossen, nur noch im Falle eines griechischen Angriffes Widerstand zu leisten. Doch Kolokotronis dachte nicht an einen Angriff. Er wollte seine Leute schonen und überließ es Hunger und Typhus, die Stadt zu Fall zu bringen.
Auszug aus dem Roman zur „Held von Kastropyrgos. Ein Schicksal aus dem griechischen Befreiungskrieg 1821“

Im Mittelpunkt des Buches steht der widersprüchliche Charakter des Michalos Russis. Als Gutsherr und oberster Verwalter (Kotzambassis) einer kleinen peloponnesischen Stadt hat er sich mit den türkischen Besatzern bestens arrangiert. Sein Dasein wird von klaren Werten bestimmt: Geld und Wohlstand, Liebe zum Leben, Abscheu vor dem Tod. Russis ist ein Bilderbuch-Opportunist, der sein Mäntelchen geschickt nach dem Wind hängt. Er hält wenig von Umstürzen, der Geist der Revolution ist ihm zuwider. Der unerwartet erfolgreiche Verlauf des Aufstandes zwingt ihn jedoch, sich der Sache der griechischen Nation anzuschließen: Er gelangt durch Zufall an die vorderste Front und wird dort unfreiwillig zum Helden. Der „Held von Kastropyrgos“ ist ein Buch über Liebe, Lüge und Verrat – und vor allem: Es ist große Literatur.